Umfrage zur Zukunft des Studios für Elektronische Musik des WDR Köln 2001
Hervorgeholtmit Beiträgen von Carola Bauckholt, Ludger Brümmer, Paulo C. Chagas, Ulrich Dibelius, Péter Eötvös, Johannes Fritsch, Johannes Goebel, Erhard Grosskopf, Georg Hajdu, Georg Heike, York Höller, Klaus Huber, Hans Ulrich Humpert, Johannes Kalitzke, Thomas Kessler, Armin Köhler, Gottfried Michael Koenig, Helmut Lachenmann, György Ligeti, Harald Münz, Vorstand des Muwi-Instituts der Universität zu Köln, Frank Niehusmann, Ralf r. olleres, Younghi Pagh-Paan, Robert HP Platz, André Ruschkowski, Frederic Rzewski, Marcus Schmickler, Dieter Schnebel, Kilian Schwoon, Gerhard Stäbler, Joachim Stange-Elbe, Karlheinz Stockhausen, Manos Tsangaris, Elena Ungeheuer und Pascal Decroupet sowie Caspar Johannes Walter
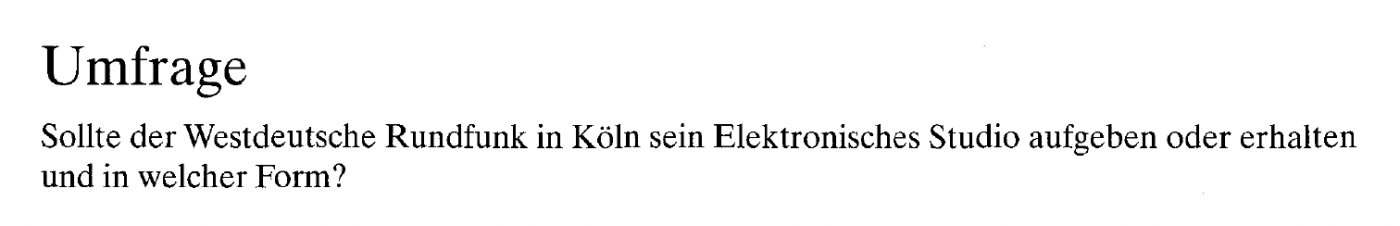
Die Zukunft des legendären Studios für Elektronische Musik (SEM) des WDR Köln ist auch ein Vierteljahrhundert nach der Schließung im Jahr 2000 immer noch offen. 1951 formell gegründet und 1953 mit ersten Arbeiten hervorgetreten, wurde das SEM durch die Verbindung der damaligen Analogtechnik mit Verfahren der additiven und subtraktiven Klangsynthese zu einem Magneten für Komponisten aus der halben Welt. Fast fünfzig Jahre lang wurde hier elektroakustische Musik produziert, erst in den letzten Jahren auch von zwei Komponistinnen: Unsuk Chin und Younghi Pagh-Paan. In den 1980er Jahren wurde das Studio aus dem Kölner Funkhaus in eine Immobilie des WDR in der Annostraße der Kölner Südstadt ausgelagert. Nach langwierigem Wiederaufbau und fast fünfjährigem Produktionsstopp gab es dort unter der neuen künstlerischen Leitung von York Höller ab 1990 eine kleine Renaissance: Auf zwei Etagen war damals sowohl das voll funktionsfähige „Museumsstudio“ mit der historischen Analogtechnik der Anfangsjahre als auch das große Produktionsstudio mit neuester Digitaltechnologie und entsprechenden Soundprogrammen aus dem Pariser IRCAM aufgebaut worden.
1998 ging der WDR-Redakteur für Neue Musik, Carsten Becker, als formeller Leiter des SEM in Rente. Ende 1999 gab Höller die Studioleitung auf und der Vertrag des technischen Assistenten Paulo Chagas wurde nicht verlängert Als letzter Mitarbeiter des SEM verblieb der festangestellte Toningenieur Volker Müller. Da der WDR die Liegenschaft in der Annostraße verkaufte, musste das Studio dort 2001 ausziehen. Der damalige WDR-Intendant Fritz Pleitgen versuchte, das SEM der Hochschule für Musik und Tanz Köln als Geschenk anzudienen, was diese als Ausbildungseinrichtung aber ablehnen musste. Zudem kursierten Szenarien von Verkauf, Verschrottung, Musealisierung und Wiederaufbau. In dieser Situation veröffentlichten die MusikTexte in Heft 88 (Februar 2001) eine Umfrage zur Zukunft des SEM. Es beteiligten sich 36 Persönlichkeiten verschiedener Expertise, Einrichtungen und Länder aus Komposition, Elektronik, Hochschule, Rundfunk, Musikwissenschaft. Getragen von der Hoffnung, die damals geäußerten Ideen, Wünsche, Forderungen, Visionen und Bedenken mögen der immer noch nicht geklärten Standortsuche für das SEM neuen Nachdruck verleihen, haben wir diese vielstimmige und aspektreiche Umfrage erneut hervorgeholt. Etwa zeitgleich führte im März 2001 Stefan Fricke für den SWR ein Interview mit dem damaligen Programmchef von Kulturradio WDR3 Karl Karst, der sich damals erstaunlich zuversichtlich über den baldigen Wiederaufbau des SEM äußerte.
Während des seitdem vergangenen Vierteljahrhunderts gab es viele mehr oder weniger gute Pläne zum Wiederaufbau des SEM, die sich allesamt zerschlugen. Für Forschung, Lehre, Vermittlung und künstlerische Produktion der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollte das SEM in der HfMT Köln, im Museum für Angewandte Kunst Köln, im 1927 errichteten Gebäude der Westdeutschen-Rundfunk AG in Köln-Raderberg, im Staatlichen Institut für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz Berlin sowie im „Haus Mödrath – Räume für Kunst“, einem ehemaligen Entbindungsheim, in dem 1928 Karlheinz Stockhausen geboren wurde. Während all dieser Jahre sorgte Volker Müller bis zu seinem Tod 2021 dafür, dass das von ihm in einem Kellerraum in Köln-Ossendorf eingelagerte SEM zumindest zur Digitalisierung von Tonbändern genutzt und gelegentlich von kleinen Gruppen interessierter Fachleute und Studierender besichtigt werden konnte.
Im Februar 2022 beschloss der Rat der Stadt Köln das zu gleichen Teilen von Stadt und Land NRW finanzierte Konzept „ZAMUS 2.0 / SEM“. Der historische Komplex des Helios-Geländes in Köln-Ehrenfeld sollte für das seit 2011 hier ansässige Zentrum für Alte Musik (ZAMUS) baulich ertüchtigt, erweitert und durch das SEM als lebendiges Museum mit 250 Quadratmetern Nutzfläche ergänzt werden. Hier sollten künftig Lagerung, Wartung, Archivierung sowie Ausstellungen, Führungen, Workshops, Produktions- und Forschungsresidenzen stattfinden können. Die Fertigstellung dieses Plans war für März 2025 geplant. Doch bereits 2022 war der Vertrag mit der Eigentümer- und Investorgesellschaft Bauwens wegen überzogener Finanzforderungen geplatzt. Im Herbst 2023 übertrug der WDR den kompletten Geräteparcours des SEM per Schenkung der Stadt Köln, die als neue Eigentümerin für die Mietkosten in Köln-Ossendorf aufzukommen hat. Aktuell ist die Stabsstelle Kulturraummanagement im Kulturdezernat der Stadt, namentlich Benjamin Thele, dafür verantwortlich, eine neue Unterbringungsmöglichkeit für das SEM zu finden. Einmal mehr steht Köln vor der Alternative, mit dem Wiederaufbau des SEM entweder international zu glänzen oder sich im Fall des Scheiterns in derselben Tragweite zu blamieren.
Rainer Nonnenmann, April 2025
HIER geht es zum pdf des Beitrags
Die Veröffentlichung geschieht mit Genehmigung des Verlags MusikTexteGisela Gronemeyer (Erben). Alle Rechte vorbehalten.

Unser Angebot ist kostenfrei. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass Qualitätsjournalismus für alle verfügbar sein sollte. Mit dieser Einstellung sind wir nicht alleine: viele Leser:innen schätzen unser Engagement. Mit Ihrer Unterstützung können wir weitermachen. Nutzen Sie jetzt unser Spendenabo (schon ab 6 Euro) oder werden Sie Fördermitglied – und damit Teil unserer Community!
