Aww!
EssayCuteness als gegenwartsästhetisches Phänomen
Eine Kawaii-Katze beleuchtet die Gegenwartsästhetik
Miku schaut mich an und schnurrt. Sie ist nicht die Art Katze, die sich auf die Tastatur legen würde, wenn ich tippe. Stattdessen steht sie geduldig auf dem Schreibtisch. Ihre Kawaii-Augen leuchten. Ich habe Miku gerettet, nicht aus dem Tierheim, sondern vor dem Verstauben. Sie hatte davor einen Job an der Staatsoper Hamburg. Als „Cute Object“ maunzte sie in meiner Oper „Dollhouse“ einige Vorstellungen lang, mitten im Publikum. Überrascht haben sich die Zuschauer:innen zu ihr umgedreht, haben geschmunzelt oder gelacht, haben ihre Köpfe zusammengesteckt und leise getuschelt. Sie mochten Miku. Und das, obwohl alle wussten, dass es sich nur um eine eiförmige Plastikhülle mit angedeuteten Öhrchen, aufgemaltem ● ᆺ ● und eingebautem Lautsprecher handelte. Ich nehme Miku als Ausgangspunkt, um mit einem radikal sanften Aww! denjenigen zu widersprechen, die mit einem gewissen Anspruch auf Deutungshoheit schreiben, Neue Musik sei gefällig und anbiedernd geworden und habe ihre Träume und Utopien aufgegeben. Ich will zeigen, dass Mikus Cuteness sehr wohl ein subversiver Protest ist – nur eben nicht als laute Provokation vorgetragen.
Vor zwei Jahren sprach ich mit einem Musikphilosophen über Cuteness. Ich erzählte ihm von meinem Vorhaben, eine cute Oper zu schreiben. Er war skeptisch. „Cuteness ist eine Konsumästhetik“, sagte er, „und low culture in high culture zu integrieren, also Cuteness in die Staatsoper zu bringen, das ist postmodern. Doch die Postmoderne ist zu Ende. Das hat kein Provokationspotenzial mehr. Ich befürchte, Sie tappen da in die postmoderne Falle. Bei Jeff Koons und seinem Kitsch hat das noch funktioniert, aber das war in den 80ern, 90ern …“ Ich habe viel darüber nachgedacht. Vielleicht bin nicht ich es, sondern er, der an high-low-Wertungen und -Provokationen festhält und in die postmoderne Falle getappt ist? In einem Interview sprach die Videokünstlerin Hito Steyerl unlängst über rechts-identitäre Social Media-Kanäle, die bevorzugt mit Dreistigkeit, Schock und Ironie arbeiteten. Daher seien diese Mittel „ästhetisch bankrott. […] Die Methode der Provokation ist derzeit ganz stark reaktionär besetzt. Momentan ist es das Provozierendste, auf Provokation zu verzichten.“1 Vor diesem Hintergrund will ich Cuteness als Gegenwartsästhetik beschreiben, die in einer Zeit der gesellschaftlichen Spaltung und der lauten Power-Performances das Gegenteil riskiert: Cuteness lässt Nähe zu und fordert sie ein, gibt Verletzlichkeit preis und wagt Empathie, überwindet spielerisch starre Binaritäten, hält Ambivalenzen aus und gestaltet durch umsorgte Beziehungen Behaglichkeit. Wenn das mal keine Utopie ist!
Diese Utopie hat längst Einzug gehalten in die Sounds der Gegenwart und auch in die Konzertprogramme der Neuen Musik: Komponist:innen wie Christian Winther Christensen, Mikel Urquiza, Celeste Oram, Kristine Tjøgersen, Nina Fukuoka, Marta Śniady, Alex Paxton, Hannah Kendall, Lisa Streich, Yuri Umemoto und viele weitere nutzen in ihrer Musik Cuteness auf unterschiedliche Weise. Doch im Neue Musik-Diskurs bleibt Cuteness und ihr subversives, utopisches Potenzial bislang unterbelichtet. Mikus helle Birne soll mir helfen, das zu ändern. Ich verweise auf Mikus intellektuelles Futter aus den Disziplinen der Literaturwissenschaft,2 Gegenwartsästhetik,3 Bildenden Kunst,4 Kulturwissenschaften5 und Cute Studies,6 um nur die wichtigsten zu nennen.
Wenn wir im deutschen Sprachgebrauch den Anglizismus „cute“ benutzen, dann tun wir das, wie Annekathrin Kohout feststellt, bewusst, um Konnotationen, die in „süß“ und „niedlich“ enthalten sind, zu negieren oder zu umgehen: „Mit ‚cute‘ will ich nicht etwas benennen, was harmlos ist oder was rein oberflächlich ist oder was kindlich ist – sondern ich will eigentlich zeigen: Cute ist mehr als das. Cute ist etwas, mit dem ich versuche, eine Haltung zu artikulieren, die über so eine Naivität hinausgeht.“7 Man könnte auch sagen: Als Jugendkultur ist „cute“ das neue „cool“. Und so wie in den 90ern ziemlich alles als cool bezeichnet werden konnte, ist im heutigen, allgemeinen Sprachgebrauch „cute“ ein breiter Begriff. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass Cuteness im Vergleich zur Coolness Nähe statt Distanz betont und weniger kompetitiv und ausgrenzend, vielmehr sozial interaktiv und einladend ist. Dass Coolness ihre Wurzeln in der Straße als männliche Kampfzone hat8 und Cuteness mit Kindlichkeit und Weiblichkeit in Verbindung gebracht wird, soll historisch aufgezeigt und zugleich kritisch hinterfragt werden – zumal heute, wo Genderdispositive, geschlechtliche Implikationen und binär-verengende Narrationsmuster gesellschaftlich verhandelt und transformiert werden.
„Once you ‚got‘ Pop, you could never see a sign the same way again.“ Auf dieses berühmte Andy Warhol-Zitat beziehen sich Moritz Baßler und Heinz Drügh, wenn sie für das Verstehen von Gegenwartsästhetik den Anglizismus „getten“benutzen. Es geht darum, Bedeutungen, Beziehungen und Referenzen zu erfassen, zu „getten“. Es geht darum, cute Sounds als Utopie, den subversiven Protest unter Mikus Plastikhülle zu getten. Und es geht darum, eine Auseinandersetzung über die Gegenwartsästhetik der Cuteness zu beginnen und so eine zukünftige „Stilgemeinschaft“ zu bilden, die „in der Lage [ist], das ästhetische Urteil in seiner Komplexität nachzuvollziehen und somit den angesonnenen Stil zu ‚getten‘ (‚Yes, we see.‘).“9

Mit dem Abspielen dieses Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube. Mehr dazu unter policies.google.com/privacy.
Das quietschende Baby-Krokodil
In einem Experiment wurden die Reaktionen von Schwarzen Kaimanen auf Jungtierlaute untersucht. Dazu wurde über einen Lautsprecher ein Baby-Kaiman-Schrei abgespielt, den es bei einem Raubtierangriff ausstieß. Während die ausgewachsenen Tiere sich protektiv dem Laut näherten, verharrten die anderen Jungtiere und stießen ebenfalls Raubtierangriffsschreie aus. Werden hingegen „undisturbed context“-Rufe von Jungtieren abgespielt, reagieren die ausgewachsenen Kaimane wenig, während sich die anderen Jungtiere mit gesteigertem Spielverhalten dem Lautsprecher nähern. Kaiman-Jungtiere können verschiedene Qualitäten von Lauten erzeugen, die zu unterschiedlichen Reaktionen führen: „Similarly to many birds, juvenile crocodilians use a call repertoire that supports anti-predator tactic, group cohesion, mother-juvenile localization and parental care.“10
Kaiman-Jungtiere können Laute erzeugen, die bestimmte Verhaltensweisen auslösen: Fürsorge, Schutz oder Spiel- und Sozialverhalten. Das ist insofern interessant, als das von Konrad Lorenz 1943 beschriebene „Kindchenschema“ die gleichen Reize auslöst, die Beschreibung sich allerdings auf visuelle Merkmale beschränkt: große und tiefliegende Augen, ein im Vergleich zum Körper großer Kopf, kurze und rundliche Extremitäten und ungeschickte Bewegungen. Nach Lorenz finden wir alles mit derartigen morphologischen Merkmalen niedlich, und unsere Vorliebe für das Niedliche beruht auf dem Drang, es zu nähren und zu umsorgen. Auch heute wird das Kindchenschema als Framework in allen Cuteness-Definitionen herangezogen, in einer allgemeineren Lesart, die von positiven affektiven Reaktionen spricht, die auch kulturell bedingt sind. Joshua Dale schlägt vor, „whether our response to cuteness is innate or learned, cuteness may be best understood as an appeal – intentional or unconscious, made by an animal- or human-like entity – that seeks to trigger a particular affective response.“11
Die schwarzen Kaimane des Experiments haben kein Jungtier gesehen, sondern nur dessen Rufe aus einem Lautsprecher gehört. Trotzdem konnten eindeutige Verhaltensreaktionen gemessen werden. Gibt es demnach ein auditives Kindchenschema? Ein weiteres Experiment hat dies bestätigt: Kognitionswissenschaftlich wurde gemessen, dass auditive und visuelle Reize die gleichen Gehirnaktivitäten auslösen. Auch auditive Sinneseindrücke wecken demnach Fürsorge und steigern Empathie, Sozial- und Spielverhalten.12
Sowohl visuell als auch auditiv ist das Kindchenschema als symbolische Metaform zu verstehen. Die Wahrnehmung von Cuteness funktioniert als Code: Verschiedene Formen und Merkmale werden erkannt und erlauben es Produzent:innen und Interpret:innen, diesen Elementen Bedeutung zu verleihen. In kulturellen Artefakten kann das Kindchenschema somit auch in abstrakter oder reduzierter Form Care- und Play-Verhalten auslösen.13 Auch ohne Kulleraugen kann ein Kaimanbaby umsorgt werden – sein niedliches Quietschen genügt. Folgen wir diesem Ruf und beobachten, was sein Klang mit uns macht.
Musik, die mich zart macht
Nachdem wir das Kindchenschema um eine klangliche Dimension erweitert haben, rückt nun das Hören selbst in den Fokus. Wie nehme ich Musik wahr, wenn sie niedlich klingt? Oder anders gefragt: Wie muss meine Wahrnehmung beschaffen sein, um überhaupt einen Klang als niedlich zu hören? Obwohl cute zweifelsohne ein ästhetisches Urteil ist, steht nicht die Analyse oder das Bewerten im Vordergrund, sondern ein zugewandtes Hören. Ich nenne es: niedliches Hören.
Das Live-Hörspiel „Yunge Eylands Varpcast Netwerkið“ von Celeste Oram14 und dem Ensemble Adapter beispielsweise beschäftigt sich mit Elfen in der isländischen Mythologie. An einer Stelle, die diesen Fabelwesen gewidmet ist, spricht nur die Musik – zart, atmosphärisch, magisch.
Wie kann ich meine eigene Hörhaltung beschreiben? Ich lasse mich von dieser Musik verzaubern, kindlich entzücken. Ich fühle mich zurückversetzt in eine Zeit, in der Märchenwesen noch Kraft hatten. Mit großen Augen höre ich dem Feenstaub zu – und glaube daran. Diese Musik ist zart. Aber vor allem macht sie auch mich zart. Meine Hörhaltung ist ein assoziatives, zugewandtes Hören. Ich lasse mich auf die Musik ein, werde zu ihrem Resonanzraum. Sie regt in mir etwas an. Sie regt mich an. Dieses Hören unterscheidet sich vom analytischen Hören, das verstehen, einordnen, bewerten will. Es unterscheidet sich aber auch vom rein passiven Genuss. Ich höre nicht nur zu, ich nehme teil. Ich spiele mit.
Annekathrin Kohout beschreibt diese Rezeptionshaltung als „niedlichen Blick“:15 eine Haltung voller Dankbarkeit, Demut, Liebe, Nachsicht und Versöhnlichkeit. Eine emphatische Zuwendung, die Andersartigkeit nicht nur akzeptiert, sondern liebevoll anerkennt. In der Musik findet sich eine Entsprechung in Horst Rumpfs Begriff des „hörenden Hörens“: eine Aufmerksamkeit, die nicht auf Wiedererkennung oder Einordnung zielt, sondern sich vom Hier und Jetzt des Gehörten treffen lässt. Rumpf nennt sie „pathisch getönt“ – eine Kultur des Hörens, die der schnellen Erklärung entsagt.16
Cuteness stellt sich im Moment des Zuhörens ein. Der Klang wird niedlich gehört, weil der:die Hörer:in niedlich hört. Das Urteil „cute“ ist weniger kognitive Bewertung als vielmehr eine affektive Reaktion und entsteht im Akt des Sich-Einlassens. Diese Haltung betrifft Publikum, Interpret:innen und Komponist:innen gleichermaßen. Die (Stil-)Gemeinschaft der niedlich Hörenden erkennt darin auch eine politische Dimension: In einer Zeit, in der das Laute dominiert und das Distanzierende durchdringt, hat dieses Hören eine subversive Qualität, weil sie ihre Aufmerksamkeit dem Leisen und Kleinen zuwendet.
Die Liebe der Kinder
Wenden wir unsere Aufmerksamkeit den Kleinen, den Kindern zu. Die heutige Allgegenwart von Cuteness ist eng mit einer Neubewertung von Kindheit verbunden, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Nordamerika und Europa einsetzt: Zunächst wurde das Kind als schützenswertes Wesen anerkannt – mit der Folge des rechtlichen Verbots von Kinderarbeit und sexualisierter Gewalt. Seit den 1970er- und 80er-Jahren beginnen sich zudem die Grenzen zwischen Kindheit und Erwachsenenalter aufzulösen: Kinder agieren zunehmend als autonome Subjekte, auch hinsichtlich ihres Konsumverhaltens, während das „innere Kind“ in der Selbstkonzeption der Erwachsenen an Bedeutung gewonnen hat.
Obwohl Cuteness oft als kindlich oder naiv abgewertet wird, ist sie als Ästhetik gerade „in its intrinsic indeterminacy between the childlike and the mature, the blank face and the knowing face, the asexual and the sexual, […] remarkably attuned to the zeitgeist.“17
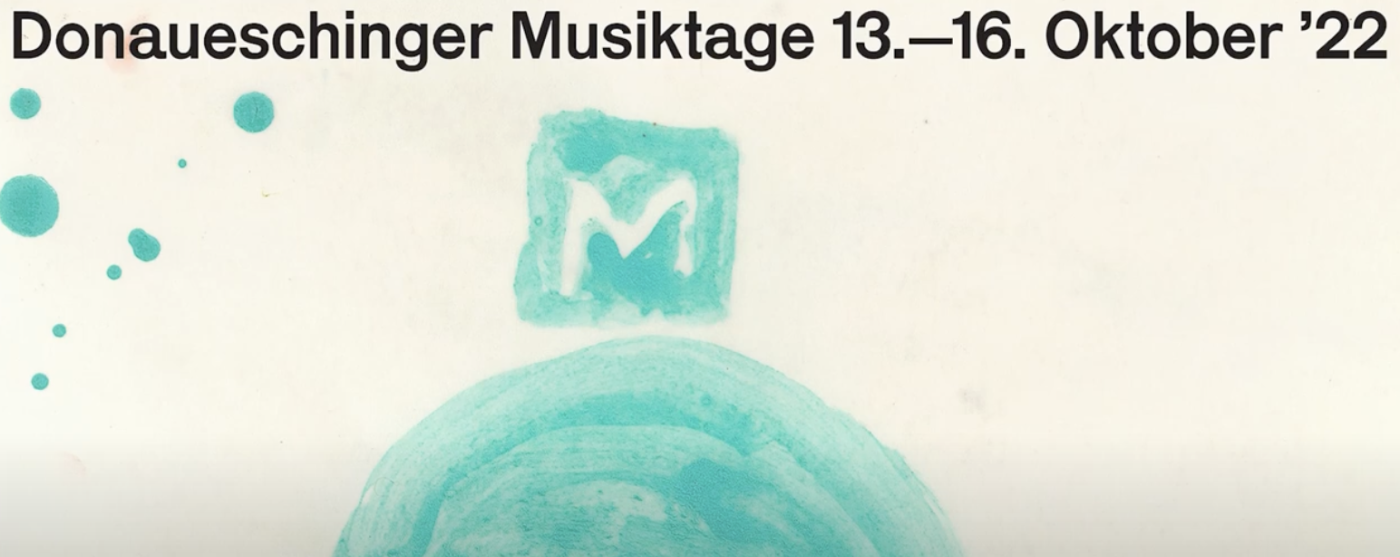
Mit dem Abspielen dieses Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube. Mehr dazu unter policies.google.com/privacy.
Diesen Zeitgeist greift Christian Winter Christensen in seinem Stück „Children’s songs“ (2022) auf. Hier wird Kindheit zum Spielfeld. Er nähert sich ihr affirmativ. Selbst Vater von zwei Kindern, spielt er mit Referenzen und mit zarten Klängen, die bei der Uraufführung in Donaueschingen so leise waren, dass man sie fast überhören konnte. (Der Mitschnitt hingegen klingt geradezu brutal laut und unnatürlich nah mikrofoniert.) Wir hören Tonleitern, Akkordfolgen, Oktaven. Fragmente wiederholen sich, werden geloopt, geraten in maschinelle Bewegung. Eine Dynamik an der Grenze des Hörbaren, angedeutete Kinderlieder und ein hochpräzises Ensemble: Christensen spielt mit Erinnerungen, Nostalgie und Versatzstücken aus vergangenen Zeiten. Dafür, dass es dabei nicht sentimental wird, sorgenabrupte Schnitte und Passagen mit hoher Bewegungsenergie, aber auch der comichafte Klang der Blechbläser, die mit Harmon Mutes wie Donald Duck quaken.
In der Mitte des Stücks fährt eine Leinwand vor den Pianisten, montiert auf eine Lego Duplo-Eisenbahn. Der amplifizierte Elektromotor summt. Auf die Leinwand wird ein singendes, aber lautloses Mädchen projiziert, dann fährt der Leinwand-Zug – „brrrrrrr“ – wieder zurück und das Stück geht weiter. Am Ende bauen zwei Schlagzeuger ein Haus aus Lego Duplo. Spätestens hier werden die Musiker des Ensemble Ascolta zu Spielern, vielleicht: zu Kindern.
Nach der Uraufführung frage ich Christensen, ob „Children’s Songs“ ein cutes Stück sei. Er antwortet: „Nein, es geht um Kindheit.“ Dann aber ergänzt er einen Satz, der voller Cuteness ist: „In einer Welt wie dieser, so komplex, überfordernd, das macht mich so traurig, ich weiß nicht … da wollte ich der Welt Liebe geben. Die Liebe der Kinder.“
Christensen entwirft einen zarten Gegenpol zur Erwachsenenwelt, ein Spiel mit Erinnerungen, Affekten und Spielzeugklängen. Wir tauchen ein in eine eigene Welt: Es ist die Welt des Spiels.
Cuteness als Ästhetik des Spiels
Ich möchte selbstbestimmte Cuteness als eine Form des Spiels beschreiben. – Ist das authentisch oder nur eine Fassade? Meint sie es ernst oder nicht? Ist er wirklich so naiv oder kokettiert er damit? Cuteness kann verunsichern, weil sie eine soziale Maske ist, die bewusst getragen und abgelegt wird. Ihre Kraft liegt in der Ambivalenz – in der Unbestimmtheit zwischen Spiel und Ernst, Authentizität und Inszenierung.
Mit Mikel Urquizas Kuckuck vertiefen wir uns in Cuteness als Ästhetik des Spiels. Ich beziehe mich dabei auf Roger Caillois’ Konzept der „Mimicry“, dem Spiel der Verstellung.18 Caillois beschreibt den „Hang des Menschen, sich zu verstellen, zu verkleiden, eine Maske zu tragen, eine Rolle zu spielen“19 – eine Vorliebe, die tief mit Theater, Puppenspiel und dem kindlichen Symbolspiel verbunden ist. Die Motivation dahinter: der Wunsch, ein:e andere:r zu sein oder als solche:r gelesen zu werden – nicht um zu täuschen, sondern um lustvoll mit Identität zu spielen. Die drei Funktionen der Maske beschreibt Caillois als: Verstecken, Verwandeln, Erschrecken. Die Spielform der Mimikry kann laut Elisabeth Heyne als „eine spezifische Form des Weltbezugs und Modus der Weltaneignung“20 verstanden werden. Wieder Caillois: „Die mimicry ist eine unaufhörliche Erfindung. Die Spielregel ist einzigartig: Der Akteur ist verpflichtet, den Zuschauer zu faszinieren, und er muss jeden Fehler vermeiden, der letzterem die Illusion zerstören würde; der Zuschauer wiederum muss bereit sein, sich der Illusion hinzugeben, ohne sich von vornherein gegen das Dekor, die Maske und die künstliche Welt zu wehren; er muss der Einladung Folge leisten, muss eine gegebene Zeit an sie glauben, so als sei sie eine Wirklichkeit jenseits der Wirklichkeit.“21

Mit dem Abspielen dieses Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube. Mehr dazu unter policies.google.com/privacy.
Urquizas Stück „Cucú“ spielt mit genau dieser Maskerade. Die gute Laune des frechen Kuckucks ist ansteckend. Der Kuckuck versucht sich an einem höfischen Tanz, etwas schräg, aber charmant – „funny-cute“. Die Vorlage, Juan del Encinas Renaissance-Madrigal „Cucú, cucú, cucucú, guarda no lo seas tú“, wird von Urquiza scharf und skurril instrumentiert. Die eröffnende Kuckucksterz überträgt er auf eine schmierig intonierende Lotusflöte. Das Tempo wählt er bewusst flott, sodass es, wie auch sein Umgang mit der Renaissance-Harmonik, überdreht wirkt. Urquiza macht den Lotusflöten-Kuckuck zum Protagonisten des kurzen Stücks und schärft ihn charakterlich. Man könnte auch sagen: Die Performance des Kuckucks wird cuter.
Dabei arbeitet Urquiza mit einer historischen, artifiziellen Tierdarstellung: Der Kuckuck ist nicht Naturlaut, sondern es sind Menschen, die einen Kuckuck imitieren. Die Musik ist verspielt, vieldeutig, spöttisch. Es ist ein Maskenball, und unter der Kuckucksmaske streckt der Kuckuck frech seine Zunge heraus. Wir werden hinters Licht geführt – und genießen es.
Während Christensen mit Erinnerung und Fragilität arbeitet, nutzt Urquiza das komische Potenzial von Maskerade. In beiden Fällen ist Cuteness eng mit der Welt des Spiels verbunden – mit der Sphäre der Kindheit beziehungsweise mit der Lust an Imitation und Täuschung. Was beide verbindet: die Freude an der Darstellung und eine verspielte, manchmal augenzwinkernde Kommunikation mit dem Publikum. Performing cute.
Performing Cute – was wir von Barbie lernen
„Barbie ist pink und ein Spielzeug für Kinder, aber sie ist nicht niedlich und schon gar nicht cute“, schreibt Annekathrin Kohout über die Barbie unserer Kindheit. Die Barbie aus Greta Gerwigs Film (2023) hingegen wird in ihrer Verletzlichkeit cute – dann nämlich, „wenn ihre Starrheit und Perfektion schwindet, wenn Hartes, Unnachgiebiges weich und aus dem kalten, da maskenhaft-normierten Habitus plötzlich ein warmes, überraschendes und emotionales Verhalten wird.“22
Cute zu performen heißt, Imperfektionen und emotionale Durchlässigkeit nicht als Schwäche, sondern als Stärke zu zeigen – ein pop-feministischer Akt, ein leiser Widerstand gegen das Patriarchat. Gleichzeitig ist Gerwigs Barbie auch eine Reproduktion stereotyp feminin codierter Narrative: pink, blond, normschön. Der Pop-Feminismus ist sich dieses (internalisierten) Male Gaze (vgl. „Wer spielt hier für wen?“) bewusst und spielt mit der Differenz zwischen Fremdzuschreibung und selbstermächtigender Performance. In ihrem Essay „Die subversive Kraft der Tussi“ beschreibt Jovana Reisinger dies als performative Überhöhung: „Pink, Girlieness und Styling als subversives Machtinstrument statt als Unterminierung der Emanzipation. […] Die Tussi fühlt sich in ihrer Außenwirkung auffallend wohl – sie ist nicht künstlich, sie ist willentlich ein Kunstobjekt.“23 Die Tussi spielt eine Rolle, als Gratwanderung zwischen Realität und Spiel, die verbunden mit der Nichterfüllung von gesellschaftlichen Normen auf eine performative Überhöhung von Gender-Stereotypen hinausläuft, die zugleich deren Unterkomplexität ausstellen.
Vor diesem Hintergrund wird die Barbie-Puppe nicht nur zur Projektionsfläche des Weiblichen, sondern steht auch für eine Affirmation von (Beauty-)Konsum, Plastik/Oberflächlichkeit und exklusiver Girlkultur, die insofern exklusiv ist, als Spieler:innen sich auf die Barbiewelt und die damit verbundenen Regeln einlassen müssen, um mitspielen zu dürfen. Gerwigs Barbie ist eine selbstbestimmte Akteurin, die ihr Aussehen und ihre Accessoires als Maske bespielt. Sie will faszinieren und gefallen. Wer sich auf ihr Spiel einlässt und sich der Maske hingibt, wird Teil ihres Versprechens: „Another world is possible.“ Eine Welt, in der Barbie sich sexy fühlen kann, ohne Opfer sexualisierter Gewalt zu werden. Eine Welt, in der Cuteness als Teil einer (weiblichen) Performativität eine Machtposition einnimmt.

Mit dem Abspielen dieses Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube. Mehr dazu unter policies.google.com/privacy.
In diesem Kontext erklingt Billie Eilishs Song „What Was I Made For“. Hauchig, weich, fast brüchig – Eilishs Stimme verbirgt ihre Gebrochenheit, Imperfektion und Verletzlichkeit nicht, sondern stellt sie aus. Sie widersetzt sich dem Diktat von Stärke und Lautheit. Ihre stimmlich artikulierten Selbstzweifel werden zum Resonanzboden ihrer Fans und Hörer:innen und zum Ausdruck von Nähe, Intimität, Mitgefühl und Verbundenheit. Dabei greift Eilish auf die Gesangstechnik des Croonings24 zurück, die im frühen 20. Jahrhundert mit der Entwicklung des Mikrofons aufkam. Im Vergleich zu klassischem Gesang oder dem Belting25 wirkt Crooning leiser, sanfter, unangestrengter, ist der Sprechstimme ähnlicher und dadurch auch textverständlicher. Eilish gibt der ausgestellten Verletzlichkeit der Gerwig-Barbie einen emotionalen Ausdruck. Radikale Sanftheit – damit können wir ihre Stimme verknüpfen: zart, aber nicht minder stark, sanft und zugleich durchdringend…

Mit dem Abspielen dieses Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube. Mehr dazu unter policies.google.com/privacy.
Inwiefern ist Eilishs Umgang mit Stimme auf Männerstimmen übertragbar? Entscheidend ist weniger die Stimmlage als vielmehr die mit der Stimme verbundene Intention, Haltung oder Ausdruck. Insofern ist meine These: Cuteness beschränkt sich nicht auf „Girl Culture“; und erst recht müssen wir uns aus dem Gefängnis binärer Geschlechterrollen befreien, um Cuteness zu getten. Verstehen wir also, an Annekathrin Kohout anschließend, „‚Girlkultur‘ eher [als] eine Ästhetik als ein Geschlecht“.26 Denken wir Girl mit Asterisk und einen offenen Kulturbegriff mit ausfransenden Rändern, dann können wir sagen: Männer – oder Boys* – bedienen sich der gleichen Ausdrucksmittel wie Frauen* und Girls*, um cute zu performen. Dies zeigt sich exemplarisch bei einer Coverversion von „What Was I Made For“ durch den Countertenor Vinny Marchi.27 Im Falsett singt er die Rolle des Barbie-Kens. Cuteness und die darin eingeschriebenen Genderimplikationen werden zur (post-)ironischen Maske. Sein Countertenor klingt etwas fokussierter und weniger hauchig als Eilishs Stimme, aber trotzdem bewusst zart. Er übernimmt (ehemals) weiblich codierte Ausdrucksmittel und Zuschreibungen und verschiebt und überwindet so die geschlechtlichen Implikationen des Niedlichen. Sein Cover zeigt: Eine cute Stimme ist – unabhängig vom Geschlecht – eine kalkulierte Performance.
Wer spielt hier für wen?
Cute Selbstzuschreibungen, subversive Selbstverniedlichung – Cuteness kann empowernd sein. Doch im Kontext des Spiels stellt sich die Frage: Wer spielt hier eigentlich für wen? Niedlichkeit wird bewusst eingesetzt, um Frauen beziehungsweise Frauenkörper zu verkleinern, zu objektifizieren und zu sexualisieren. Da diese „Ästhetik der betonten Hilflosigkeit und Verletzlichkeit“28 nicht nur Beschützer- und Fürsorgeinstinkte weckt, sondern auch in Verbindung mit dem „aggressive[n] Wunsch [steht], das niedliche Objekt zu beherrschen und zu unterwerfen“,29 wohnt dem Verhältnis zwischen aktivem:r Betrachter:in und passivem niedlichen Objekt Gewalt inne, wie Sianne Ngai schreibt.30
Zwei Begriffe sind im Folgenden zentral:
- „Agency“ bezeichnet die Fähigkeit von Subjekten, innerhalb kultureller und gesellschaftlicher Strukturen selbstbestimmt zu handeln. Besonders im Kontext marginalisierter Gruppen steht der Begriff für Handlungsmacht und Gegenrede gegen hegemoniale Normen.
- Der Begriff „Male Gaze“ (männlicher Blick) stammt aus der feministischen Filmkritik. Im alltagssprachlichen Gebrauch wird er benutzt, um eine männliche Sichtweise zu kritisieren, die Frauen objektifiziert und sie auf ihr körperliches, sexuelles Äußeres reduziert.

Mit dem Abspielen dieses Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube. Mehr dazu unter policies.google.com/privacy.
Den männlichen Blick auf vermeintlich schwache Frauen thematisiert Nina Fukuoka in „The Final Girl“, das explizit für eine weibliche Harfenistin komponiert ist. Es verhandelt das Gendering des Instruments und das damit verbundene Stereotyp der „süßen“ Harfenistin.31 Nach einer Minute schöner Harfenklänge und der Videoeinblendung „Cute Girl Playing Harp“ wird eine Männerhand sichtbar, die eine Lobotomie demonstriert – ein brutaler Eingriff, der im 20. Jahrhundert vor allem bei als „hysterisch“ diagnostizierten Frauen vorgenommen wurde.32 Fukuoka verbindet das stereotype Bild der engelsgleichen Harfenistin mit popkulturellen Verweisen auf „Final Fantasy“, schwarzweißen Hollywood-Clips und dem medizinhistorischen Diskurs um weibliche Hysterie. Die Komponistin schreibt: „Many symptoms of this alleged medical condition were just signs of normal functioning female sexuality, but thanks to a lack of scientific knowledge female hysteria remained in use as a medical term until the 20th century.“33
Etwas freier interpretiert handelt „The Final Girl“ von einem Mädchen, dem „cute girl“, der Heldin, die loszieht, um in der Welt Abenteuer zu bestehen. Sie wird dann aber vom Male Gaze klein gemacht und für „hysterisch“ gehalten. Dem Assoziationsgeflecht aus Harfe, weiblich und cute wird die „Hysterie“ und deren Behandlung, präziser gesagt: die dadurch begründete Misshandlung gegenübergestellt. Deutlich und kontrastscharf adressiert Fukuoka geschlechtsbezogene Stereotype und Machtgefälle.
Cuteness weckt Beschützerinstinkte. Die Komponistin zeigt, dass dieses Beschützen zur Beschränkung, zum Verbot, ja im schlimmsten Fall zur Gewalt werden kann, die Männern an Frauen verüben. Cuteness wird zum Korsett, wenn sie keine Selbst-, sondern eine Fremdzuschreibung ist, wenn dem Subjekt die Agency abgesprochen wird und es von einem Male Gaze objektifiziert wird.
Eine Frage der Technik
Auch das folgende Beispiel lässt sich als Fall normativer Kontrolle von weiblichem Selbstausdruck lesen. Aber ich glaube, es ist mehr als das: eine stimmliche Verfremdung hin zu einer Cyborg-Voice zwischen Mensch und Maschine. Und mit Legacy Russells Glitch Feminism34 argumentierend, erfreuen wir uns an maschineller Fehlbarkeit: wenn die digital kontrollierte Stimme das normative Korsett durchbricht.

Mit dem Abspielen dieses Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube. Mehr dazu unter policies.google.com/privacy.
Schauen wir zuerst das 2011 veröffentlichte Video „eHarmony Video Bio“.35 Mit „I love cats“ verliert „Debbie“ ihre Affektkontrolle, ihre Katzenliebe überwältigt sie. Der Moment wirkt zwar over the top, aber dennoch authentisch. Doch das Video ist inszeniert, eine Performance der Entertainerin Cara Hartmann.

Mit dem Abspielen dieses Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube. Mehr dazu unter policies.google.com/privacy.
Auf YouTube erscheint das Auto-Tune-Mashup „Can’t Hug Every Cat“.36 Aus „Debbies“ Original wird ein Song, der ihre Aussagen so zusammenschneidet, dass ein Songtext entsteht. Ihre Sprechstimme wird per Auto-Tune in Gesang verwandelt. Dazwischen: musizierende Katzen. Ihr Affektausbruch wird durch den Effekt stimmlich und als Popsong formal kontrolliert, das heißt: in eine „richtige“, standardisierte Form gebracht. Die (vermeintlich) spontane Gefühlsäußerung wird zum Popsong mit Refrain und somit zur reproduzierbaren Geste: eine Upbeat-Nummer mit Ohrwurmcharakter.
Auto-Tune wurde 1996 als Korrektur-Tool entwickelt und 1998 in Chers “Believe” ikonisch zweckentfremdet: Der Effekt bleibt hörbar. Die Auto-Tune-Stimme ist artifiziell, glatt, „entkörperlicht“. Gerade diese Ambivalenz zwischen Nähe und Fremdheit, zwischen Authentizität und Artifizialität, Identifikation und Andersartigkeit macht ihren Reiz aus. Der beschriebene Auto-Tune-Effekt ist besonders stark, wenn der Gesang absichtlich out of pitch gesungen ist. Das Singen mit Auto-Tune ist daher „ein Duett zwischen Mensch und Maschine“.37 Auto-Tune stellt eine digital erzeugte Standardisierung und eine Nivellierung von stimmlicher Individualität dar. Im Anschluss an das generische Gesicht – dem Phänomen, dass der Einsatz von Gesichtsfiltern eine kollektiv archetypische Gesichtsform erzeugt hat38 – können wir sagen: Auto-Tune erzeugt das Ideal einer generischen Stimme, die keine stilistischen Nuancen und intonatorischen Unsauberkeiten kennt. Die auto-getunte Stimme wirkt gewohnt, unspezifisch und austauschbar. Die Ent-Individualisierung der Stimme (und damit auch des singenden Körpers) trägt dazu bei, dass die Stimme zur Projektionsfläche und damit popkulturell anschlussfähig und (aufmerksamkeits-)ökonomisch verwertbar wird.
Im Sinne von Mimikry kann Autotune als Maske der digitalen Modulation verstanden werden. Da auch Maschinen fehlbar sind und digitale Effekte Artefakte erzeugen, liegt gerade im Glitch das cute Potenzial einer anrührenden, auditiven „Machine Cuteness“. Auto-Tune als Stilmittel, das die technischen Fehlbarkeiten bewusst artifiziell ausstellt, ist als Beziehung zwischen Mensch und Maschine zu verstehen, ja es lässt sich „als neue Form der Intimität zwischen Mensch und Maschine beschreiben.“39
Debbies Katzenliebe war von Anfang an gespielt – doch wir können uns damit im Auto-Tune-Mashup leichter, ja spielerischer identifizieren als im Original. Der Effekt, der ihre Stimme entmenschlicht, macht Debbies Emotionen zugleich anschlussfähiger. Hören wir die autogetunte Stimme also als Paradox zwischen emotionalem Ausbruch und dessen stimmlich-technischer Kontrolle. Anders gesagt: Wir müssen nicht alle Katzen umarmen, um zu begreifen, dass der Ausdruck von Zuneigung auch eine Frage der Technik ist.
Franks Ohr wird abgeschleckt
Klicken wir uns durch den YouTube-Kanal „ASMR Zeitgeist“,40 dann begegnen wir Frank. Frank ist ein Mikrofon, ein für ASMR eingesetztes Kunstkopf-Mikrofon mit Ohren. Es ermöglicht eine räumliche und nahe Mikrofonierung – eine mikrofonierte Nähe –, wie sie für ASMR als digital übermitteltes Care Audio typisch ist.
ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) bezeichnet einen psychosensorischen Effekt: sanftes Kribbeln auf der Kopfhaut und entlang der Wirbelsäule. Diese „Tingles“ werden durch Reize, sogenannte „Trigger“ ausgelöst, etwa durch leise Geräusche oder Flüstern. ASMR ist ein Netzphänomen mit Millionenpublikum, das Entspannung, Beruhigung, Einschlafhilfe oder emotionale Regulation verspricht.
Bei ASMR bekommen kleine Geräusche, die im Alltags-Noise oftmals überhört werden, mittels einer audiotechnischen Verstärkung eine verstärkte Aufmerksamkeit. Dabei spielt der durch binaurale Aufnahmetechnik erzeugte Eindruck von Immersion eine wesentliche Rolle. Zum Einsatz kommt ein Kunstkopf, das heißt eine Kopfnachbildung mit künstlichen Ohren, in denen Mikrofone eingebaut sind. Die akustische Quelle wird extrem nah an die Mikrofone herangeführt, bis hin zur Berührung der Mikrofone – was sonst in der Aufnahmetechnik vermieden wird. Dies erzeugt Intimität: „These sounds are intimate because to be audible they must be physically near the listener.“41 Wir sind dabei – aber nur in unseren Kopfhörern. Ganz nah dran und distanziert-isoliert zugleich. Dass durch Verstärkung auch Hintergrundgeräusche oder das Rauschen der Vorverstärkung angehoben wird, ist Teil der Ästhetik. Auch hier gilt: Das Medium wird nicht versteckt, sondern erfahrbar gemacht. Bei „ASMR Zeitgeist“ hat das auch eine narrative und visuelle Entsprechung: Die Mikrofone heißen Frank, Alex und Bob und bekommen videoanimierte Augen, die auf die Geräusche reagieren. „ASMR Zeitgeist“ personalisiert und cutifiziert die Technik.

Unter dem Aspekt von Cuteness als Ästhetik der Behaglichkeit möchte ich ASMR als auditiven Rückzugsraum verstehen: Eingerichtet mit lauter kleinen Dingen, die uns nahe sind, ermöglicht dieser Raum uns ein körperliches und seelisches Gefühl von Wohlbefinden. Es handelt sich um einen imaginären Raum, der beim Hören entsteht und der entgrenzt vom tatsächlichen Raum stattfindet, in dem wir uns – isoliert unter Kopfhörern – befinden. In diesem Raum wird Intimität suggeriert beziehungsweise technisch übermittelt: Der Kunstkopf wird zum Avatar, seine Höreindrücke werden die unseren. Das ist eine interessante Verschiebung: Wir identifizieren uns weniger mit der:dem flüsternden Sprecher:in als vielmehr mit dem Mikrofon vor ihm. Und so genießen wir als Kunstkopf Frank, dass eine Katze unser Ohr abschleckt – und sind zugleich froh über die Distanz: dass es Franks Ohr ist, und nicht unseres, das gerade Katzenspucke-nass geworden ist.
Melanie Martinez’ „Dollhouse“ als Bühne der falschen Behaglichkeit

Mit dem Abspielen dieses Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube. Mehr dazu unter policies.google.com/privacy.
Auch Melanie Martinez richtet einen Rückzugsraum mit lauter kleinen Dingen ein – doch statt Wohlbefinden entsteht Unbehagen. In ihrem Song „Dollhouse“ (2014) entpuppt sich Cuteness als behagliche Oberfläche, die unbehagliche Tiefen, ja Abgründe verbirgt und zugleich erahnen lässt: „creepy-cute“. Im „Dollhouse“ lebt eine Puppenfamilie, die sich nach außen hin als „perfekt“ zu inszenieren weiß: „Hey girl, open the walls / Play with your dolls / We'll be a perfect family.“ Martinez verkörpert die Tochter dieser nur scheinbar perfekten Puppen-Middle Class Family, die in ihren vier Wänden Alkoholismus, Drogenkonsum und Untreue versteckt. Die visuelle Ästhetik bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Girlie-naiv-niedlicher Welt und den darin enthaltenen Grausamkeiten. Das Behagliche der eigenen vier Wände, das Heimelige, kippt ins Unbehagen, ins Unheimliche. Cuteness als Mittel der Subversion spielt hierbei eine wesentliche Rolle.
Das Puppenhaus fungiert als Repräsentation normativer Werte, hinter denen der „Wunsch nach Komplexitätsreduktion in einer überfordernden Gegenwart [steht]: (Rück-)Bezüge auf Konzepte wie die biologische Kernfamilie oder die Repräsentation ‚klarer‘, oftmals rosa-blauer Geschlechterrollen.“42 Doch diese strahlend-glatte Puppen-Fassade ist eine falsche Inszenierung, hinter der dysfunktionale Familiendynamiken zum Vorschein kommen. „Creepy-cute“ beschreibt den Kipppunkt, an dem das Niedliche bedrohliche Züge annimmt und die vertraute kindliche Spielwelt ins Unheimliche umschlägt. Die Puppe – das Spielzeug, das unbelebte Objekt, die Projektionsfläche – entwickelt ein Eigenleben und verlässt dabei den Raum der unschuldigen Kinderfantasie.
Musikalisch unterstützt „Dollhouse“ diese Spannung: Die tickende Uhr zu Beginn verweist auf die Vergänglichkeit von Kindheit – oder ist es eher ein Aufziehmechanismus, der die Puppen als Automaten lebendig erscheinen lässt? Die mechanische Präzision verstärkt das Gefühl, dass es dem belebten Puppenhaus an echter Menschlichkeit fehlt. Glockenspiel und Xylophon – Instrumente, die mit Kindlichkeit in Verbindung stehen – sind markante Klangfarben des Songs. Sie schaffen eine spielerische, kindlich-harmlose Atmosphäre, in die sich Melanie Martinez’ weiche, hauchige Stimme gut einfindet. Im Kontrast dazu stehen atmosphärische Grusel-Sounds und bedrohliche Glockenschläge.
Im Kontext von Cuteness als Ästhetik der Behaglichkeit wird sichtbar, dass das Puppenhaus traditionell genau diese Behaglichkeit symbolisiert: Sicherheit, Schutz, Geborgenheit, ja eine heile Welt wird im Puppenhaus nachgespielt. Martinez zeigt deren Gemachtheit. Die Behaglichkeit des Middle Class-Puppen-Eigenheims bekommt Risse, da Martinez gegen die ihr zugewiesene, passive Puppenrolle aufbegehrt. Aus Martinez’ Perspektive ist das Puppenhaus nämlich keine heile Welt, sondern ein Gefängnis.
Behaglichkeit ist ein Balanceakt zwischen Freiheit und Sicherheit. Erstarrte Freiheit und überprotektive Sicherheit wirken unbehaglich und creepy. Gelingt dieser Balanceakt hingegen, entsteht ein cuter Raum der Behaglichkeit: Sicherheit und Wohlbefinden stehen in einer Balance zu dem Wunsch nach Freiheit und Selbstentfaltung. Diese Behaglichkeit lebt von Beziehung: zwischen dem Subjekt und ihrem Schutzraum, ihrem Safe Space. Sich wohlzufühlen ist schließlich kein passiv erlebter Zustand, sondern bedarf einer aktiven Beziehungspflege. „Comfort“ setzt „care“ voraus: Der Raum tröstet und beruhigt mich, er tut mir wohl („comfort“), wenn ich mich um ihn sorge („care“).
Cuteness als Konservierungsmittel

Mit dem Abspielen dieses Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube. Mehr dazu unter policies.google.com/privacy.
Diese dynamische Beziehung möchte ich abschließend als Zugewandtheit beschreiben. In Abgrenzung zu Cute Animal Media, die Tiere in Social Media-konforme Bildausschnitte pressen, um unterhaltsame Aufmerksamkeit zu generieren, hören wir bei Kristine Tjøgersen einen Gegenentwurf. Ihr Stück „Starry Night“ regt unsere Imagination an: Die Grenze zwischen Mensch und Natur wird aufgelöst und so eine post-humane Utopie entworfen. Statt Tiere zu verniedlichen oder zu vermenschlichen, erkundet Tjøgersen eine Symbiose von Mensch, Tier und Umwelt jenseits eines anthropozentrischen Blicks. Insofern knüpft Tjøgersen an ein zentrales Motiv dieses Essays an: eine gestaltete, umsorgte und hierarchiefreie Beziehung. Denn „Starry Night“ lädt dazu ein, die Natur nicht als etwas anderes, Fremdes zu begreifen, das beherrscht oder beschützt werden muss, sondern als gleichberechtigte Akteurin in einem komplexen Beziehungsgeflecht.
Mit viel Hall versehene, arpeggierte Zither-Akkorde erklingen; über- und ineinander erklingen die Akkorde G- und D-Dur, anschließend C- und F-Dur. Sie bleiben die einzigen Harmonien des Stücks und verschieben sich durch das Übereinanderschichten farbig-facettenreich. In einem langsamen, organisch atmenden Tempo wechseln sich diese zwei Harmonien ab, ruhig pendelnd. Mikrotonal schwebende Obertöne von Bassklarinette und Sopransaxophon kommen hinzu. Ein hohes Tremolo der Geige hier, einem Zirpen gleich, ein Multiphonic-Triller der Bassklarinette da. Ein geräuschhaft schwirrendes Cello, dann setzt eine Frauenstimme auf dem Vokal „u“ ein und wird zum mehrstimmigen Gesang. Mittels eines Vocoders wird sie zur elektronisch-hybriden Stimme, die stets Teil des organischen Klanggemischs bleibt. Beinahe zeitgleich beginnen zugespielte Vögel zu singen. Schwärmende Geräusche der Mehrklang-Triller spielenden Flöte, weiche Flageoletts der Geige. Die Klangwolke fadet aus und zurück bleibt ein leises Geräusch, das schließlich auch verstummt.
Das Stück ist Teil des Musiktheaters „BOWER“, inspiriert von Laubenvögeln und ihrem Balzverhalten. Männliche Laubenvögel beeindrucken ihre Weibchen mit einem aufwendig gebauten Balzplatz, der Laube („bower“). Auf der Website der Komponistin steht als Werkbeschreibung: „We have placed this bower in a deep forest from the distant future, and it becomes unclear if it is birds or humans that are in the center of attention.“43 Als posthumane Utopie sagt die Musik gleichsam etwas über den Menschen, die Natur und die Mensch-Natur-Beziehung aus. Ich sehe in dieser Utopie einen Link zu Donna Haraways Konzept des Chthuluzän, einer Epoche, in der alle Lebensformen sich miteinander verflechten, um gemeinsam, jenseits einer anthropozentrischen Kontrolle, die Zukunft zu gestalten: „Im Chthuluzän sympoetisch zu arbeiten und zu spielen heißt, die biodiversen Kräfte von Terra zu erneuern. Anders als das Anthropozän und das Kapitalozän setzt sich das Chthuluzän aus Fortsetzungsgeschichten und artenübergreifenden Praktiken des Miteinander-Werdens zusammen. Sein Fortdauern steht auf dem Spiel. […] Wir stehen füreinander auf dem Spiel.“44
Die Natur wird bei Tjøgersen als vielschichtige verwobene Realität erlebbar, als ko-kreatives Zusammenwirken von Mensch und nicht-menschlichen, „beyond human“ Wesen. Entsprechend ist auch der Einsatz des Vocoders in „Starry Night“ zu verstehen: eine hybride Mensch-Maschine, die auch als post-humanes Ideal einer koexistierenden Zukunft zwischen Technologie, Mensch und Natur gehört werden kann. Der beruhigende, mit Vocoder-Effekt versehene Gesang ruft Assoziationen archaisch-ursprünglicher Wiegenlieder hervor. Diese von der Natur bzw. von der imaginierten Natur ausgehende beruhigende Wirkung erweitert die Beziehung zwischen Beschützer:in und Beschütztem: Nicht nur wir beschützen die Natur, sondern sie beschützt auch uns. Ein Geben und Nehmen, ein Miteinander-Werden.
Um eine kritisch-distanzierte Auseinandersetzung geht es in „Starry Night“ nicht. Die der natürlichen Schönheit diametral entgegenstehende und doch mit ihr verbundene menschliche Zerstörung wird nicht thematisiert. Die Geige zirpt, das Cello schwirrt, die Flöte rauscht schwärmend, die Obertöne schweben. Eine mimetische Abbildung der Natur wird hier künstlerisch erweitert, ästhetisiert und zu einem kompositorisch gewählten Ausschnitt, zu einem imaginären Raum geformt. Wir sind mittendrin und vergessen darüber hinaus gerne die künstliche beziehungsweise künstlerische Setzung, den Ausschnitt. „Starry Night“ zeigt nicht die unberührte Natur, sondern eine erfundene, idealisierte. Es fehlt jede Kritik oder Auseinandersetzung mit der Gemachtheit dieses Naturidylls. Na und? Das gemeinsame Bewahren, das Erhalten, das Konservieren der Schönheit, als schillernde und zugleich fragile Lebendigkeit und Farbigkeit, ist dennoch in „Starry Night“ eingeschrieben. Und vielleicht ist Cuteness dabei nicht das schlechteste Konservierungsmittel.
Donna Haraway schreibt: „Es ist von Gewicht, welche Gedanken Gedanken denken; es ist von Gewicht, welche Erzählungen Erzählungen erzählen.“45 Tjøgersens „Starry Night“ hat Gewicht, weil in einer Mischung aus Eskapismus, Utopie und Gegenwartsbewältigung eine (musikalische) Erzählung eine Erzählung erzählt, wie wir Beziehungen neu gestalten können. Wie wir uns der Welt zuwenden können, wie wir aktiv Nähe herstellen können, auch indem wir uns selbst öffnen und verletzlich zeigen. Wie wir einen offenen Umgang mit anderen und anderem leben können. Wie wir uns darauf einlassen und wie wir Differenzen aushalten können. Wie wir uns mit ausgestreckten Fühlern, mitfühlend, der Welt zuwenden und ein Netz aus Beziehungen spinnen können, über Grenzen der Spezies hinweg. Wie wir uns radikal sanft gegen Normen der individuellen Stärke und der existenziellen Größe widersetzen können. Wie wir all dies im Bewusstsein tun können, dass auch eine leise Erzählung eine Erzählung bleibt, wir jedoch die Wärme der Fiktion, das innere Feuer brauchen, um die Brände dieser Welt zu löschen.
Dieser Text beruht auf der Sendung "Endlich niedlich! Neue Musik, die „cute“ klingt" von Clemens K. Thomas und Friedemann Dupelius, ausgestrahlt am 29. Oktober 2023 im WDR3. Redaktion: Patrick Hahn.
1 Steyerl, Hito: „Plötzlich bin ich eine militärische Fachkraft“, in: ZEIT 22/2025. https://www.zeit.de/2025/22/hito-steyerl-filme-kunst-provokation/komplettansicht (28.06.25).
2 Ngai, Sianne: „Die Niedlichkeit der Avantgarde“ [2005], in: Ngai, Sianne: „Das Niedliche und der Gimmick“, Leipzig 2022.
3 Baßler, Moritz / Drügh, Heinz: „Gegenwartsästhetik“, Konstanz 2021.
4 Kohout, Annekathrin (Hg.): „Cuteness. Das Niedliche als ästhetische Kategorie“, KUNSTFORUM Band 289, Köln 2023.
5 Blome, Eva et al. (Hg.): »Süüüüß!«, Zeitschrift für Kulturwissenschaften 01/2022, Bielefeld 2022.
6 Dale, Joshua Paul et al. (Hg.): “The Aesthetics and Affects of Cuteness”, New York 2017.
7 Kohout, Annekathrin, in: Dupelius, Friedemann / Thomas, Clemens: „Endlich niedlich! Neue Musik, die ‚cute‘ klingt“, Radiosendung im WDR 3 vom 29.10.2023.
8 Harris, Daniel: „Cute, Quaint, Hungry and Romantic. The Aesthetics of Consumerism”, New York 2000, S. 52f.
9 Baßler / Drügh 2021, S. 70.
10 Vergne, Amélie at al.: “Acoustic signals of baby black caimans”, in: Zoology 114, Amsterdam 2011.
11 Dale 2017, S. 4.
12 Vgl. Kringelbach, Morten et al.: “On Cuteness: Unlocking the Parental Brain and Beyond”, in: “Trends in Cognitive Sciences”, Amsterdam 2016.
13 Vgl. Dydynski, Jason Mario: “Modeling Cuteness: Moving towards a Biosemotic Model for Understanding the Perception of Cuteness and Kindchenschema”, Berlin 2020.
14 https://celesteoram.com/Yunge-Eylands-Varpcast-Netwerkid-2022-a-live-radio-play
15 Vgl. Kohout, KUNSTFORUM 2023, S. 63f.
16 Rumpf, Horst: „Die andere Aufmerksamkeit“, in: Grimmer, Frauke et al. (Hg.): „Künstler als Pädagogen“, Mainz 2008, S. 14.
17 May, Simon: “The Power of Cute”, Princeton 2019, S. 143.
18 Caillois, Roger: „Die Spiele und die Menschen. Maske und Rausch“, Berlin 2017. Im Folgenden Seitenangaben im Fließtext.
19 Caillois 2017, S. 43.
20 Heyne, Elisabeth: Wissenschaften vom Imaginären, Berlin 2020, S.182.
21 Caillois 2017, S. 46.
22 Kohout, Annekathrin: „Die neue Niedlichkeit“, ZEIT online 2023, https://www.zeit.de/kultur/2023-07/cuteness-anglizismus-zeitgeist-verletzlichkeit (29.06.25).
23 Reisinger, Jovana: „Die subversive Kraft der Tussi, oder: In Barbiecore gegen das Patriarchat“, Vogue 2022, https://www.vogue.de/mode/artikel/subversive-kraft-der-tussi-barbiecore-feminismus-jovana-reisinger (23.07.24).
24 Crooning ist eine als intim wahrgenommene Pop-Gesangstechnik, bei der nah am Mikrofon gesungen wird, leise, ohne Stütze und ohne zu drücken, teilweise mit hohem Hauch- oder Flüsteranteil.
25 Belting ist eine in Pop und Rock mittlerweile standardisierte Gesangstechnik, bei der laut, mit Bruststimme und mit hochgedrücktem Kehlkopf gesungen wird.
26 Kohout, KUNSTFORUM 2023, S. 59.
27 https://youtu.be/h57O_VEf65U?si=AlGO63wrzTvxm0eu (23.07.25).
28 Ngai 2022, S. 97.
29 Ngai 2022, S. 97.
30 Vgl. ebd., S. 108.
31 https://youtu.be/LyQs4EC7ong?si=bYAgkjmpCFpqIDi4 (06.08.24).
32 Vgl. Schlich, Thomas: “Cutting the body to cure the mind”, in: The Lancet Psychiatry, Vol. 2 / 2015, S. 390.
33 https://vimeo.com/326196065 (06.08.24).
34 Vgl. Russell, Legacy: „Glitch Feminismus, ein Manifest“, Leipzig 2021.
35 https://www.youtube.com/watch?v=mTTwcCVajAc (10.07.25).
36 https://youtu.be/sP4NMoJcFd4?si=Qmy32zLfzXM5Badm (10.07.25).
37 Åkervall, Lisa: „Die Wahrheit von Auto-Tune“, in: Navigationen. Zeitschrift für Medien- und Kulturwissenschaften, 2/2015, S. 94.
38 Kohout, Annekathrin: „Schau mich an!“, https://www.zeit.de/2025/22/filter-soziale-medien-instagram-tiktok-aussehen-gesicht (10.06.25).
39 Åkervall 2015, S. 94.
40 https://www.youtube.com/@asmrzeitgeist (12.06.25).
41 Smit, Naomi et al.: “ASMR, affect and digitally-mediated intimacy”, in: “Emotion, Space and Society”, 2018, https://doi.org/10.1016/j.emospa.2018.11.002 (12.06.25), S. 5.
42 Zipfel, Hannah: „Unheimlich niedlich!? Creepy-cute Weiblichkeit bei Melanie Martinez“, in: Richard et al. (Hg.): „#cute. Inseln der Glückseligkeit“, Bielefeld 2020, S. 68.
43 https://kristinetjogersen.no/BOWER (14.10.24)
44 Haraway, Donna: „Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän“, Frankfurt 2018, S. 80.
45 Haraway 2018, S. 59.

Unser Angebot ist kostenfrei. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass Qualitätsjournalismus für alle verfügbar sein sollte. Mit dieser Einstellung sind wir nicht alleine: viele Leser:innen schätzen unser Engagement. Mit Ihrer Unterstützung können wir weitermachen. Nutzen Sie jetzt unser Spendenabo (schon ab 6 Euro) oder werden Sie Fördermitglied – und damit Teil unserer Community!
