Das Andere der Neuen Musik
RezensionThe Electric Guitar Diaries – Darmstadt Sonicals #1
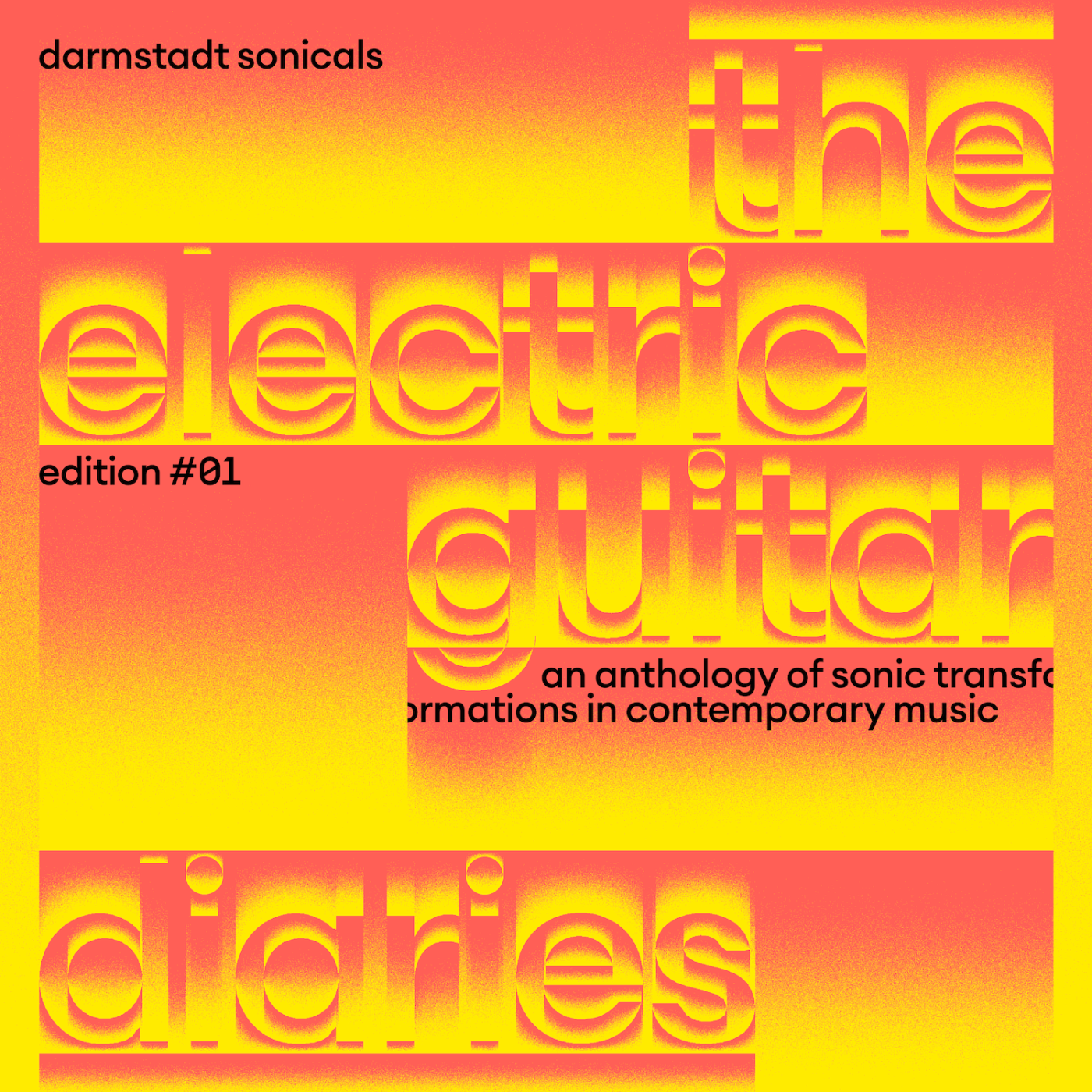
Seit ihrer Gründung 1946 sind die Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik ein Brennpunkt der neuesten Entwicklungen zeitgenössischer Musik. Das Archiv des veranstaltenden Internationalen Musikinstituts Darmstadt (IMD) ist entsprechend über die Jahrzehnte zu einem reichen Speicher der Geschichte der Neuen Musik angewachsen. Je älter das Neue wird, desto komplexer werden die eingelagerten Geschichten und ermöglichen Lektüren langfristiger historischer Entwicklungen.
Genau dies unternimmt die auf den Ferienkursen 2025 präsentierte „Anthologie klanglicher Transformationen in der zeitgenössischen Musik“, eine Veröffentlichung von drei Vinylplatten mit einem großen Beiheft in knallig gelb-orangenem Design. Das auf mehrere Ausgaben hin angelegte Projekt wird vom IMD, der Musik Akademie Basel und der Hochschule für Musik Basel herausgegeben und speist sich aus den Beständen des Archivs des IMD, ergänzt durch Aufnahmen von den Ferienkursen durch verschiedene Rundfunkanstalten. Initiator und Kurator ist der Gitarrist Yaron Deutsch, der ausgiebig im Archiv stöbern und forschen konnte und – wohl nicht von ungefähr – als ersten Faden der Transformationsgeschichte die E-Gitarre gewählt hat.
Mit „The Electric Guitar Diaries“ versammelt Deutsch teils unveröffentlichte Konzertmitschnitte von Werken mit E-Gitarre aus den Jahren 1964 bis 2023 und zeichnet aus der Perspektive eines Instruments einen großen Bogen ästhetischer Entwicklung nach. Doch ist dieses Instrument nicht irgendeines, sondern stellt, wie Christoph Haffter in einem der beiden Essays im Beiheft herausstellt, einen Eindringling in das Instrumentarium der Neuen Musik dar. Erst 1960 setzt diese Geschichte mit einem Stück von Mauricio Kagel ein, der in „Sonant“ für Gitarre, Harfe, Kontrabass und Perkussion auch eine E-Gitarre besetzt. Auch wenn Kagel die besonderen Möglichkeiten des elektrischen Instruments in fast serieller Manier registriert – wie zwei abgedruckte Skizzen aus der Paul Sacher Stiftung belegen –, bleibt die Gitarre in der freien Form des Stücks eingebettet in den Ensemblezusammenhang und sticht in der überwiegend leisen Komposition nur selten heraus. Erst in einer Version für Solo-Gitarre, die der prägende Gitarrist Karl-Heinz Böttner angefertigt hat, kommt die ungewohnte Klanglichkeit des elektronischen Instruments zur Geltung. In den beiden Versionen des Stücks zeigt sich dadurch eine gewisse Ratlosigkeit diesem Klang gegenüber, die auf der B-Seite der ersten Platte zur Methode wird: Lukas Foss’ „Paradigm“ von 1969 nutzt die starke symbolische Aufladung der E-Gitarre für eine satirische Komposition gegen das Establishment der Neuen Musik. Nach einem schrammelnden ersten Satz untermalen einzelne Akkorde eine Tirade von gesprochenen Worten, die die fünf Musiker:innen dem Establishment entgegenschleudern: „Deine rührseligen Gelüste“, „kontrollierte Liebkosungen (zwölf Töne)“ oder „mit deinen vornehmen Lorbeeren, hinterhältigen Methoden“. Das gut hörbare Publikum nimmt diese Satire mit Gelächter und Jubel auf, was den Geist des Protests vor dem Hintergrund der 68er-Jahre gerade im „fremden“ Instrument der E-Gitarre unterstreicht.
Die Problemstellung der ausgewählten Klangbeispiele ist damit gesetzt: Wie geht die Neue Musik mit dem Anderen um, das in Gestalt der E-Gitarre die Symboliken von publikumswirksamer Popkultur und anti-intellektualistischem Ausdruck in Rock und Punk verkörpert? Auf den folgenden beiden Platten wird die Beantwortung dieser Frage anhand von spannungsreichen Paaren zwischen alt und neu verfolgt. Die zweite Platte eröffnet mit „La Tempesta d’après Giorgione“ von Hugues Dufourt (1976, Mitschnitt 1982), der die Klanglichkeit der E-Gitarre sui generis nutzt, um instrumental die dunkel dräuenden Farben von Giorgiones berühmtem Gemälde von 1508 zu evozieren. Mit dem Rückgriff auf die italienische Renaissance überspringt die spektrale Komposition den jüngeren historischen Ballast, den Alexander Schubert im folgenden Stück dagegen betont: „Bird Snapper“ von 2012 ist eine Komposition für Rockband mit Saxofon, Keyboard, E-Gitarre, E-Bass und Stimme. Die verwegene Aura der Band wird hier künstlerisch für eine Spionage-Geschichte genutzt, die durch Überzeichnung der Punk- und Metal-Topoi beklemmende Verwicklungen und kalte Trostlosigkeit heraufbeschwört.
Ähnlich fügt „Red Shift“ von Louis V. Vierk aus dem Jahr 1989 die rockige Ästhetik von Barré-Akkorden, Crash-Becken und einem frühen Keyboard-Synthesizer in eine strikt kompositorisch gedachte formale Struktur linearer Entwicklung ein. Diesem Versuch, den anderen Klang mit der eigenen Klangorganisation zu versöhnen, liegt noch immer der latente Widerspruch zugrunde. Er hat sich knapp 30 Jahre später in Clara Ianottas „Outer Space“ (2018) gänzlich aufgelöst: Die Klangwelt von Saxofon, E-Gitarre, Perkussion, „one object performer“ und Elektronik bewegt sich gänzlich im Vakuum des Alls von Klängen. Tiefe atmosphärische Klänge, Rauschen, Störgeräusche, pulsierende Vibrationen, schillernde Loops, Gerumpel, Quietschen und immer wieder Stille haben sich so sehr vom Boden der symbolischen Verwurzelung einer Klangästhetik gelöst, dass die E-Gitarre hier schon fast keine Rolle mehr spielt.
Nach einem weiteren Stück von Alexander Schubert, das in einer Sampling-Ästhetik wieder auf den Boden der mannigfaltigen Tatsachen zurückkehrt und die – postmoderne – Gleichberechtigung von Akustik und Elektronik propagiert („Point Ones“, 2012), wird die Auflösung der Dichotomie von Eigenem und Anderem im Fluchtpunkt der abwesenden Gitarre erreicht: Simon Løfflers „b“ von 2012 arbeitet nurmehr mit dem nackten Audiokontakt des Kabels ohne Gitarre und dem farbigen Rauschen des Elektronischen schlechthin. Hier würde der Bogen der von Christoph Haffter im ersten Booklet-Essay beschriebenen Entwicklung „vom Eindringling zum Paradigma“ enden und diese meisterhaft kuratierte Erzählung der E-Gitarre in der zeitgenössischen Musik abrunden – wenn sie nicht noch weiterginge.
Yaron Deutsch ist sich sehr bewusst, dass solch eine fokussierte Erzählung immer nur ein Faden in einem archivarischen Netzwerk sein kann. Deshalb gibt es jenseits der auf Platte gepressten Stücke noch zahlreiche nur digital veröffentlichte Aufnahmen aus dem Archiv des IMD, das die lineare Transformation in einer Reihe von Seitenwegen verkompliziert. Costin Mieroneanu, Horațiu Rădulescu, Tom North, Christopher Brandt, Stefan Prins, Øyvind Torvund, Jagoda Szmytka oder Christopher Trapani sind einige Namen, deren teilweise Unbekanntheit davon zeugt, was Assaf Shelleg im zweiten Essay des Booklets über die mögliche Zukunft der E-Gitarre herausstellt: Das Zusammenspiel von künstlerischer und technischer Agency „can push composers to dissociate the guitar from the popular musical scenes it had emerged from and accordingly seek to abandon stylistic markedness altogether.“ Herauszuheben ist hier „Black Sea“ vom österreichischen Composer-Performer Christian Fennesz. Seine halbstündige Performance bei den Darmstädter Ferienkursen 2010 steht beispielhaft für die gewonnene Freiheit, sich aller „affordances“ (Assaf Shelleg) zu bedienen, der Handlungspotentiale, die aus dem Instrument E-Gitarre mit all seinen Konnotationen hervorgehen. Fennesz führt einfache Akkorde wie im Indie und Rock mit elektronischer Verarbeitung und Feedbacks in offenes Klangterritorium, in den nicht-markierten Raum, den die Haupterzählung von „Darmstadt Sonicals“ erreicht hat. Hier wären zahlreiche weitere Künstler:innen zu nennen, die die Perspektive des spezifischen und durch institutionelle Begrenzungen eingeschränkten Archivs verlassen würden: Jim O’Rourke, Keiji Haino, Loren Connors, Eneko Zarazua oder Ava Mendoza sind nur einige Namen, die Genre-Grenzen von der „anderen Seite“ der Neuen Musik aufgeweicht haben und den unmarkierten Raum experimenteller E-Gitarren-Musik bevölkern. „These techniques can steer compositional aesthetics toward genre-bending and unanticipated rearticulations, now that the electric guitar is no longer a guest treated with politeness.“ (Assaf Shellig).
Die Grenzen, die auf den digitalen Seitenwegen der Veröffentlichung endgültig durchkreuzt und dekonstruiert wurden, werden jedoch auf der letzten B-Seite des kuratorischen Hauptweges wieder gezogen. So nachvollziehbar die Entscheidung ist, sich auf die Dokumente aus dem Archivbestand zu beschränken, so sehr wird hier doch wieder die Eingemeindung des unmarkierten Anderen in die Geschlossenheit des Archivs vollzogen. Elena Rykovas „know-how to skyrocket your Stratocaster and zigzag to Callisto“ (2018) öffnet zwar mit seiner grafisch-körperzentrierten Partitur den Raum für performative Herangehensweisen an das Instrument, knüpft aber auch an die kompositorische Durchdeklination von Spielarten und Präparationen an. Ebenso wird in Chaya Czernowins „Black Flower“ (2018) der E-Gitarren-Sound mit quasi seriell-methodischem Experiment endgültig in den Neue-Musik-Kanon des 21. Jahrhunderts integriert. So sehr, dass Kelley Sheehans „hot guts“ (2023) die elektrischen Sounds und Effekte von der E-Gitarre auf das klassische Instrument par excellence überträgt, die Violine. Nicht als Urteil über die jeweils eigenständigen Kompositionen, sondern in der Linie der kuratorischen Argumentation gerät dieses Ende weniger zum versprochenen Ausblick ins Offene, sondern zur Einverleibung eines „anderen“ Instruments in die historiographische Selbstvergewisserung einer Neuen Musik in der Krise. Sie ist seit jeher das Movens geschichtlicher Neubestimmungen und muss als implizite Motivation von „Darmstadt Sonicals“ verstanden werden. Denn nach dem virtuosen Spagat zwischen einer aufschlussreichen Allgemeinheit, die wie in einem Fries die jüngere Musikgeschichte plastisch werden lässt, und einer Betonung der Besonderheiten, die das Exemplarische ausreichend problematisiert, zerschellt die Zerbrechlichkeit des Unbestimmten am grundlegenden Paradox eines jeden Archivs: dass das Andere immer außerhalb liegen wird.

Unser Angebot ist kostenfrei. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass Qualitätsjournalismus für alle verfügbar sein sollte. Mit dieser Einstellung sind wir nicht alleine: viele Leser:innen schätzen unser Engagement. Mit Ihrer Unterstützung können wir weitermachen. Nutzen Sie jetzt unser Spendenabo (schon ab 6 Euro) oder werden Sie Fördermitglied – und damit Teil unserer Community!
